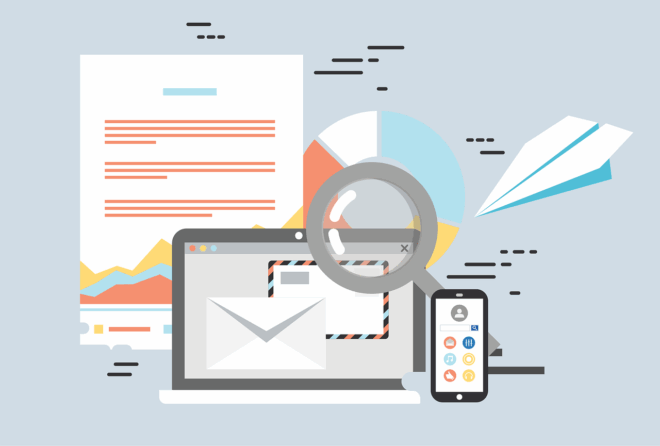
Ab Mai 2026 setzt Deutschland auf ein neues Werkzeug, das in vielen europäischen Staaten längst Alltag ist, nämlich Netzsperren. Künftig sollen Access Provider wie Telekom oder Vodafone verpflichtet werden, den Zugang zu Glücksspielseiten ohne nationale Lizenz zu blockieren. Damit folgt Deutschland einem Trend, der sich europaweit abzeichnet, hin zu stärker harmonisierten und technisch umsetzbaren Kontrollmechanismen.
Die Maßnahme ist Teil der überarbeiteten Fassung des Glücksspielstaatsvertrags 2021, die nach Ablauf der EU-Stillhaltefrist ratifiziert werden kann. Sie steht beispielhaft für die zunehmende Verflechtung von Regulierung, digitaler Infrastruktur und europäischem Wettbewerbsrecht.
Einheitliche Regeln im europäischen Binnenmarkt
Der Gesamtmarkt für Glücksspiel in Europa erreichte im Jahr 2024 ein Bruttospieleinnahmevolumen von etwa €123,4 Mrd, was einem Wachstum von etwa 5 % gegenüber 2023 entspricht und den Behörden klare Aufgaben gibt.
Das Ziel der neuen Regelung ist klar. Die Glücksspielaufsicht soll innerhalb der Europäischen Union transparenter, einheitlicher und technisch überprüfbarer werden.
Mit der deutschen Reform rückt ein Bereich ins Zentrum, der lange als Grauzone galt, und zwar die Frage, wie nationale Behörden mit Angeboten umgehen, die zwar in der EU zugelassen, aber nicht in Deutschland lizenziert sind. Plattformen mit Genehmigungen aus Malta, Gibraltar oder Zypern sind in vielen Mitgliedsstaaten legal tätig, werden jedoch unterschiedlich bewertet, sobald sie über Ländergrenzen hinweg agieren.
In diesem Zusammenhang verweisen Beobachter häufig auf die komplette Liste an Casinos ohne LUGAS, also jene Anbieter, die nicht am deutschen Sperrsystem teilnehmen, sondern über eine Lizenz anderer EU-Staaten verfügen. Diese Übersicht verdeutlicht, wie groß die regulatorischen Unterschiede innerhalb Europas weiterhin sind, und wie vielfältig der Markt trotz wachsender Harmonisierung bleibt.
Sie umfasst Betreiber, die in ihren Heimatländern reguliert sind, aber in Deutschland künftig durch DNS-Sperren eingeschränkt werden könnten, und das ist ein Umstand, der innerhalb der EU rechtlich weiterhin diskutiert wird.
DNS-Sperren und ihr nationaler Spielraum
Technisch gesehen folgt Deutschland einem Modell, das in mehreren EU-Staaten bereits erfolgreich angewandt wird. Dänemark setzt DNS-Sperren seit über einem Jahrzehnt ein, um nicht lizenzierte Angebote vom Markt fernzuhalten. Auch Belgien, Frankreich und die Niederlande nutzen vergleichbare Mechanismen.
Das Prinzip ist überall gleich: Die nationalen Glücksspielaufsichten übermitteln den Providern Sperrlisten, die verhindern, dass Nutzer auf bestimmte Domains zugreifen können. Stattdessen erscheint eine Hinweis- oder Informationsseite der jeweiligen Behörde.
In der Praxis zeigen sich jedoch Unterschiede. Während Dänemark und Schweden auf schnelle Aktualisierungen und automatisierte Systeme setzen, sind die Prozesse in Südeuropa oft langsamer. Dadurch entstehen zeitliche Lücken, in denen Anbieter ihre Domains wechseln oder spiegeln können.
Deutschland will diese Fehler vermeiden, indem es auf ein zentral verwaltetes, regelmäßig synchronisiertes System setzt. Die Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder (GGL) soll als Schnittstelle zwischen Verwaltung, Technik und Recht fungieren.
Und was sagen die Spieler dazu? Sie würden, in den meisten Fällen, am liebsten frei agieren und eben genau dort spielen, wo sie wollen.
Lizenzen, Märkte und europäische Vielfalt
Der europäische Glücksspielmarkt ist kein einheitlicher Raum, sondern ein Mosaik aus nationalen Rechtsrahmen.
Während Länder wie Spanien, Italien und Frankreich ihre Lizenzsysteme stark an nationale Vorgaben koppeln, setzen andere Staaten wie Malta oder Estland auf international ausgerichtete Modelle, die gezielt auf ausländische Anbieter zugeschnitten sind. Diese Unterschiede schaffen wirtschaftliche Dynamik, aber auch juristische Reibung.
Viele Plattformen operieren grenzüberschreitend und verweisen auf die Dienstleistungsfreiheit innerhalb der Europäischen Union. Diese erlaubt es Unternehmen, ihre Dienste in anderen Mitgliedsstaaten anzubieten, sofern sie dort rechtmäßig registriert sind.
Genau hier liegt der Knackpunkt. Nationale Aufsichten wie die GGL argumentieren, dass Glücksspiel aufgrund seiner sozialen und finanziellen Risiken nicht als gewöhnliche Dienstleistung gilt. Daher dürfen Mitgliedsstaaten strengere Auflagen erlassen. Die Europäische Kommission erkennt diese Sicht grundsätzlich an, fordert aber zugleich Verhältnismäßigkeit und Transparenz bei der Umsetzung.
Parallel zur Regulierung wächst der technologische Einfluss auf den Glücksspielmarkt. Immer mehr Anbieter integrieren Blockchain-Technologien, Smart Contracts oder Kryptowährungen in ihre Plattformen. Diese Entwicklungen machen Transaktionen nachvollziehbarer, erschweren aber gleichzeitig die Anwendung klassischer Kontrollmechanismen.
Die Herausforderung für Europa besteht darin, Innovationen zuzulassen, ohne dabei den Verbraucherschutz aus den Augen zu verlieren. DNS-Sperren sind in diesem Kontext ein Versuch, Ordnung in einen Markt zu bringen, der zunehmend dezentral und datengetrieben agiert.
Auswirkungen auf den europäischen Wettbewerb
Die Einführung von Netzsperren in Deutschland dürfte auch wirtschaftliche Folgen haben. Anbieter, die auf anderen EU-Märkten lizenziert sind, könnten den Zugang zum deutschen Publikum verlieren oder nur noch eingeschränkt erreichbar sein.
Das stärkt den nationalen Lizenzmarkt, wirft aber zugleich Fragen zur Wettbewerbsneutralität auf. Unternehmen mit EU-Lizenzen verweisen darauf, dass sie bereits strenge Auflagen erfüllen, von Spielerschutzmaßnahmen bis hin zu Transparenzanforderungen.
Gleichzeitig verschiebt sich das Gleichgewicht zwischen den großen Lizenzstandorten Europas. Malta, lange Zeit führend im Bereich internationaler Glücksspiellizenzen, steht vor der Aufgabe, ihre Verfahren an die strengeren Erwartungen der größeren Mitgliedsstaaten anzupassen. Deutschland, Frankreich und die Niederlande setzen hingegen zunehmend auf nationale Alleingänge.
Die Folge ist ein zweigeteilter Markt, auf der einen Seite hochregulierte Länder mit restriktiven Zugangsmodellen, auf der anderen flexible Standorte, die weiterhin international ausgerichtete Plattformen fördern.
Die Europäische Kommission beobachtet diese Entwicklung aufmerksam. In Brüssel gilt das Glücksspielrecht traditionell als Bereich begrenzter Harmonisierung. Das heißt, die Mitgliedsstaaten behalten weitgehend ihre nationale Gestaltungsfreiheit. Dennoch wächst der Druck, gemeinsame Standards zu schaffen, insbesondere im Bereich der Datensicherheit und Zahlungsabwicklung.
DNS-Sperren sind dabei nur ein Symptom einer größeren Bewegung: der Digitalisierung der Aufsicht. Immer mehr Länder nutzen automatisierte Systeme zur Überwachung von Glücksspielangeboten, zur Lizenzprüfung oder zur Transaktionskontrolle.
Gleichzeitig bemühen sich Aufsichten wie die GGL, eng mit anderen europäischen Behörden zusammenzuarbeiten. Der Austausch von Informationen über lizenzierte Anbieter, Lizenzentzüge oder verdächtige Zahlungsströme ist inzwischen Standard.
Europa auf dem Weg zu digitaler Kohärenz
Die deutsche Provider-Verpflichtung ab 2026 steht sinnbildlich für eine europäische Entwicklung: Glücksspielregulierung wird digital, technisch und grenzüberschreitend.
Mit der Einführung von DNS-Sperren, der Ausweitung der Lizenzsysteme und der stärkeren internationalen Kooperation entsteht ein neuer Ordnungsrahmen, der sich an den digitalen Realitäten orientiert.
Für Spieler bedeutet das mehr Transparenz darüber, welche Plattformen in welchem Land lizenziert sind. Für Anbieter entsteht ein stärker differenzierter Markt, in dem rechtliche Klarheit zur Wettbewerbsbedingung wird.
Europa bewegt sich damit auf eine Phase zu, in der Regulierung nicht länger nur als Kontrolle verstanden wird, sondern als Infrastruktur und als ein System, das Stabilität schafft, ohne Innovation zu bremsen. Der Glücksspielmarkt ist damit mehr denn je ein Spiegel der europäischen Digitalpolitik: vielfältig, vernetzt und im Wandel.
